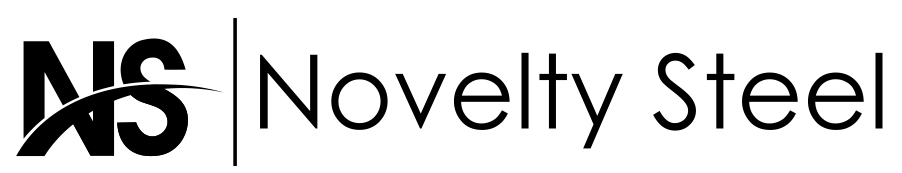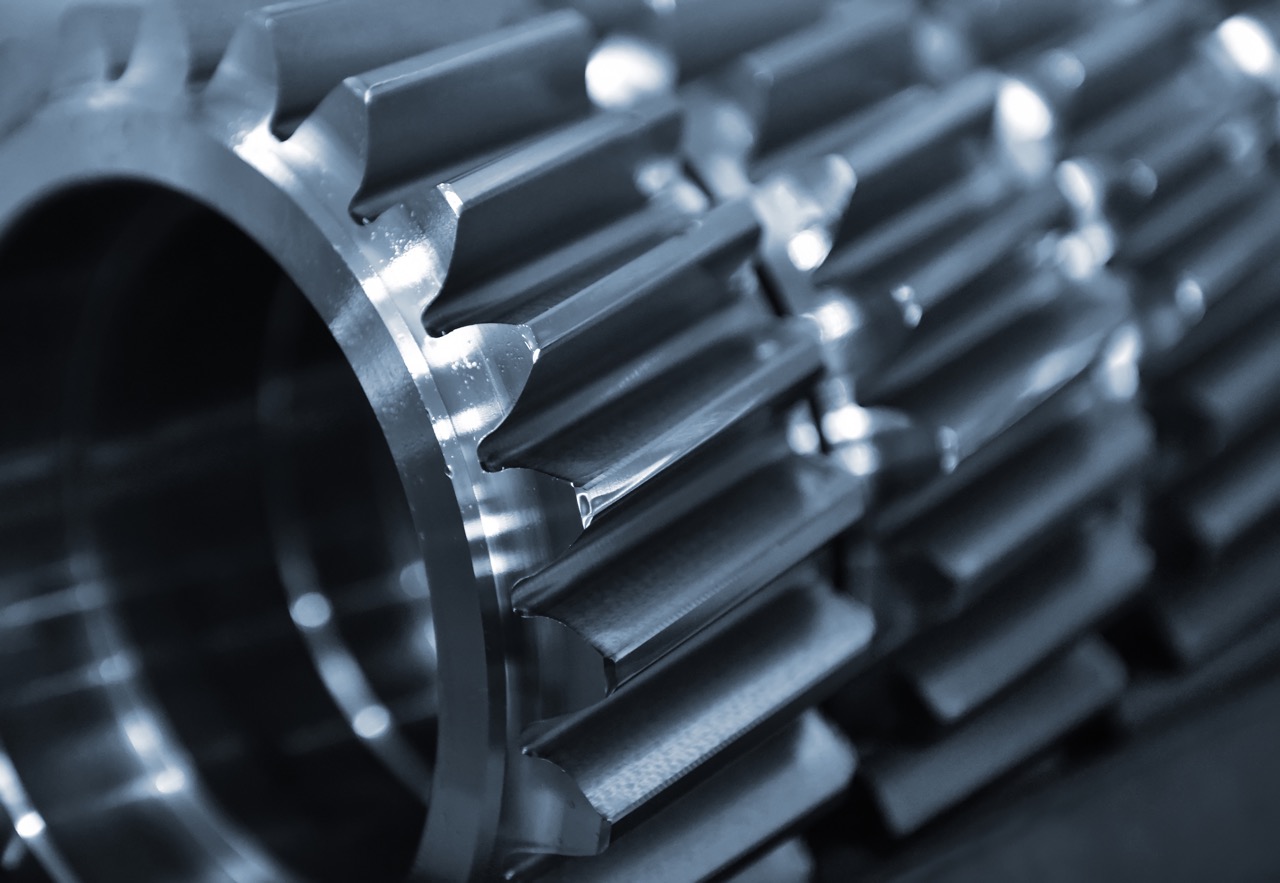
Gängige konventionelle Verfahren zur Zahnradbearbeitung umfassen Schaben, Schleifen, Honen, Läppen, Glätten und Skivving.
Diese Verfahren eignen sich zur Endbearbeitung zylindrischer Zahnräder wie Stirn- und Schraubräder. Bei Kegelrädern hingegen gelten nur Schleifen und Läppen als geeignete Endbearbeitungsverfahren.
Jedes Verfahren hat spezifische Einsatzgebiete und wird in Abhängigkeit von Zahnradtyp und gewünschter Oberflächenqualität ausgewählt.
1. Zahnradscheiden
Das Zahnradscheiden ist ein präzises Endbearbeitungsverfahren zur Fertigung von Zahnrädern.
Dabei entfernt ein Schabwerkzeug Material vom Zahnradrohling in feinen Spänen, typischerweise 100–400 µm lang und 50–150 µm dick.
Die Wirksamkeit des Prozesses hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Typ, Geometrie und Material des Schabwerkzeugs, Schabzugabe sowie die grundlegenden Parameter des Scheidverfahrens und der Scheidmaschine.
Auch das Material und die Geometrie des Zahnradrohlings spielen eine entscheidende Rolle.
Das Zahnradscheiden wird insbesondere in der Automobil- und Baumaschinenindustrie aufgrund seiner Kosteneffizienz und der erzielbaren Oberflächenqualität bevorzugt.

Abbildung 1: Zahnradscheiden
- Werkzeugtypen:
- Schrägverzahntes Schabwerkzeug: Ideal für verschiedene Zahnradtypen, mit schraubenförmiger Zahnform.
- Schabwerkzeug in Zahnstangenform: Ähnlich einem Zahnstangenrad, für lineare Scheidbewegungen.
- Schneckenförmiges Schabwerkzeug: Für Schneckenräder geeignet, mit schneckenähnlicher Zahnform.
- Scheidverfahren:
- Rotationsscheiden: Mit schraubenverzahntem Werkzeug, ideal für Großserien.
- Zahnstangenscheiden: Mit hin- und hergehender Zahnstangenbewegung, typischerweise für Zahnräder bis 150 mm Durchmesser.
- Konventionelles oder axiales Scheiden: Werkzeug und Rohling rotieren auf parallelen oder gekreuzten Achsen – für Zahnräder mit breiten Zahnflanken geeignet.
- Tangentiales oder Unterlaufscheiden: Der Zahnradrohling wird radial bewegt – effektiv für Zahnräder mit Schulter, gleichmäßiger Werkzeugverschleiß und höhere Produktivität.
- Eintauchscheiden: Direktes Eintauchen in den Rohling mit Linienkontakt – für große Stückzahlen geeignet.
- Diagonal-Scheiden: Besondere Beziehung zwischen Flankenbreite von Werkzeug und Zahnrad – hauptsächlich bei mittleren bis hohen Stückzahlen eingesetzt.
- Prozessparameter und Effizienz:
- Materialabtrag: Erfolgt durch feines, kontrolliertes Schaben und führt zu hochwertigen Oberflächen.
- Werkzeugmaterial: Abhängig von der Härte des Zahnradrohlings; gehärteter Schnellarbeitsstahl (HSS) ist gängig.
- Scheidzugabe: Entscheidend für Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität.
- Maschinenkonstruktion: Beeinflusst Effizienz und Eignung für unterschiedliche Zahnradgrößen und Stückzahlen.
- Vorteile und Einschränkungen:
- Vorteile: Kosteneffizient, verbessert die Oberflächenqualität und reduziert Teilungsfehler.
- Einschränkungen: Nicht geeignet zur Korrektur kumulierter Teilungs- oder Teilfehler; kann Riefen auf Zahnflanken verursachen.
2. Zahnradschleifen
Das Zahnradschleifen ist ein präzises Endbearbeitungsverfahren für hochfeste und gehärtete Zahnräder.
Dabei wird eine Schleifscheibe mit speziellen Schleifkörnern wie Aluminiumoxid, Siliziumkarbid oder kubischem Bornitrid verwendet. Dieses Verfahren korrigiert wirkungsvoll thermische Verzüge durch Einsatzhärtung, verbessert die Oberflächenqualität und Mikrogeometrie der Zahnräder und steigert so die Gesamtqualität. Beim Schleifen treten drei Vorgänge auf: Reiben, Pflügen und Schneiden – wobei der eigentliche Materialabtrag erst ab einer bestimmten Schwellenkraft erfolgt.

Abbildung 2: Zahnradschleifen
Das Zahnradschleifen wird hauptsächlich in zwei Verfahren unterteilt: Formschleifen und Wälzschleifen, die jeweils unterschiedliche Mechanismen und Anwendungsbereiche aufweisen.
- Formschleifen:
- Dabei wird eine Schleifscheibe verwendet, die speziell an das Evolventenprofil des Zahnrads angepasst ist.
- Dafür sind spezielle Schleifscheiben erforderlich, abgestimmt auf Modul, Eingriffswinkel und Zahnanzahl des Zahnrads.
- Es können Einzel-, Mehrfach- oder Doppelschleifscheiben verwendet werden; das Verfahren ist zwar einfacher und auch für komplexe Zahnformen geeignet, jedoch in der Regel langsamer und weniger präzise.
- Es eignet sich zum Schleifen verschiedener Zahnradtypen wie Stirnräder und Schneckenräder und verwendet entweder keramische Schleifmittel für sehr harte Zahnräder oder kubisches Bornitrid (CBN) für andere Anwendungen.
- Wälzschleifen:
- Dabei wird mit einer rotierenden Standardschleifscheibe durch synchrones Abwälzen am Werkstück das gewünschte Zahnprofil erzeugt.
- Dabei kommen verschiedene Schleifscheibenformen zum Einsatz, z. B. Gewindeschleifscheiben, Teller-, Napf- oder Zahnstangenschneckenräder.
- Das Zahnrad muss indiziert (weitergeschaltet) werden, um alle Zähne vollständig zu bearbeiten.
- Dieses Verfahren wird häufig bei Zahnrädern mit Modulen von 0,5 bis 10 mm eingesetzt.
3. Zahnradhonen
Das Zahnradhonen ist ein Feinbearbeitungsverfahren für hochfeste und gehärtete Zahnräder, bei dem ein mit Schleifmittel imprägniertes Schraubrad als Honwerkzeug verwendet wird.

Abbildung 3: Zahnradhonen
- Prozessmechanik:
- Verwendet ein mit Schleifmitteln imprägniertes Schraubrad als Honwerkzeug.
- Das Werkstück-Zahnrad wird mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 300 m/min) angetrieben und axial hin- und herbewegt.
- Die rotierende und oszillierende Bewegung erzeugt ein Kreuzschraffurmuster auf den Zahnflanken.
- Typischerweise werden 0,013 bis 0,05 mm vom Werkstück abgetragen.
- Beseitigt Kerben, Anlauffarben und kleine Unregelmäßigkeiten.
- Vorteile:
- Verbesserte Schmierstoffhaftung durch Kreuzschraffur.
- Reduziert Reibung, gleichmäßige Lastverteilung.
- Verbessert die Oberflächenqualität und Maßhaltigkeit der Zahnräder.
- Verbessert das Geräusch- und Verschleißverhalten der Zahnräder.
- Hontypen:
- Außenhonen: Werkstück und Honrad sind in gekreuzter Achsenlage miteinander im Eingriff.
- Innenhonen: Verwendet ein großes internes Schraubrad als Honwerkzeug.
- Vorteile des Innenhonens gegenüber dem Außenhonen:
- Höheres Überdeckungsverhältnis, ausgewogenerer Honkontaktdruck.
- Bessere Oberflächengüte bei geringeren Teilungsfehlern.
- Höhere Genauigkeit und Stabilität.
- Prozessparameter:
- Körnung und Typ des Schleifmittels.
- Honkontaktkraft, Drehzahl.
- Hubgeschwindigkeit und -länge der Oszillation.
- Eigenschaften des Honwerkzeugs:
- Aus festem Material gefertigt, um Verformungen unter Last zu minimieren.
- Schleifkörner in Kunstharz-, keramischer oder metallischer Bindung eingebettet.
- Verwendete Schleifmittel: Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, CBN, Diamant.
4. Zahnradläppen
Das Zahnradläppen ist ein Endbearbeitungsverfahren, das bei niedriger Geschwindigkeit und geringem Druck durchgeführt wird. Es dient der Veredelung von zylindrischen und konischen Zahnrädern aus hochfesten oder gehärteten Werkstoffen. Dabei wird kontinuierlich ein unter Druck stehendes, schleifmittelhaltiges Läppmittel aufgebracht, das die Zahnradoberflächen abträgt, um hohe Präzision und Glätte zu erzielen.

Abbildung 4: Zahnradläppen
1.Prozessübersicht:
-
- Niedriggeschwindigkeitsprozess (unter 80 U/min) mit geringem Druck.
- Verwendet ein schleifmittelhaltiges Läppmittel unter kontinuierlichem Druck.
2.Werkzeug Material:
-
- In der Regel weicher als das Werkstück-Zahnradmaterial (häufig feinkörniges Gusseisen).
- Ermöglicht das Einbetten der Schleifkörner in das Werkzeug und minimiert dadurch den Werkzeugverschleiß.
3. Läppen zylindrischer Zahnräder:
-
- Dabei wird das Werkstück mit einem zahnradförmigen Läppwerkzeug in Eingriff gebracht.
- Die Gleitgeschwindigkeit variiert entlang des Zahnprofils, weshalb eine zusätzliche axiale Gleitbewegung für ein gleichmäßiges Läppbild erforderlich ist.
4. Läppen konischer Zahnräder (z. B. Kegel-, Bogen- und Hypoidräder):
-
- Dabei werden die gepaarten Zahnräder unter kontrollierter Belastung miteinander eingelaufen.
- Beide Zahnräder werden gleichzeitig bearbeitet, wodurch keine zusätzliche Bearbeitungszugabe erforderlich ist.
5. Läppmittel:
-
- Eine kreideartige Paste aus Schleifkörnern (Körnung 300 bis 900) in einem Trägerfluid.
- Übliche Schleifmittel: Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Bornkarbid, Diamantpulver.
- Verschiedene Körnungen werden je nach Zahnradtyp und Teilung verwendet.
6. Wichtige Läppparameter:
-
- Läppdruck,
- Körnung des Schleifmittels
- Konzentration im Läppmittel
- Drehzahl.
7. Prozessvorteile:
-
- Verbessert die Oberflächenqualität, Maßgenauigkeit und das Tragbild der Zahnräder.
- Wirksam bei der Reduzierung von Geräuschentwicklung.
Wissenszentrum